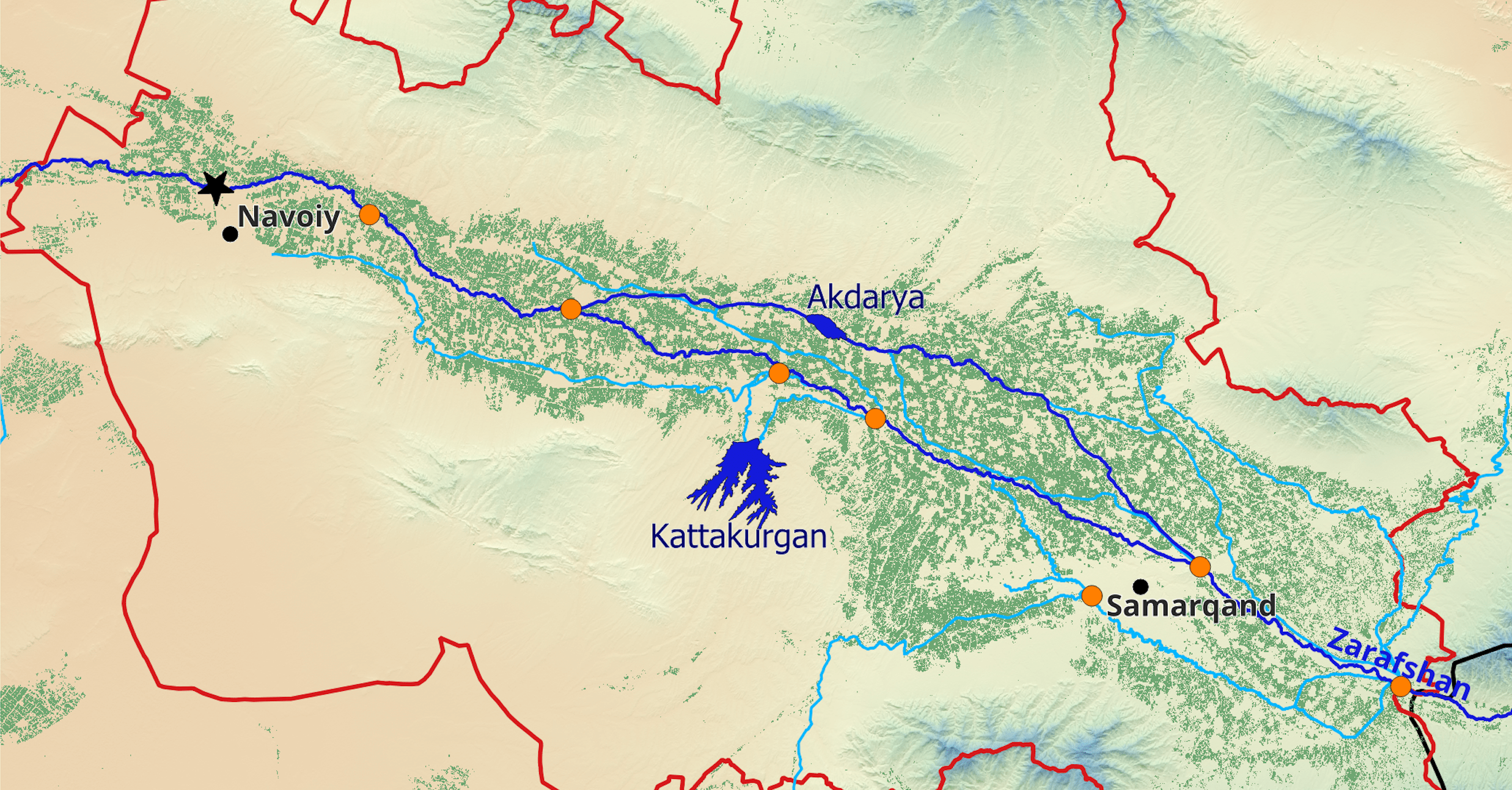Remote Sensing: Irrigated Areas in Thurgau
In der Schweiz, insbesondere im Kanton Thurgau, konfrontiert der Klimawandel die Landwirtschaft mit zunehmend trockenen Perioden, die eine effektive Bewässerungsplanung notwendig machen. Bisher fehlten jedoch präzise Daten über die Ausmasse und den Wasserverbrauch bewässerter Flächen. hydrosolutions GmbH hat ein Projekt durchgeführt, das die Möglichkeiten moderner Satellitenfernerkundung untersucht, um diese wichtige Datenlücke zu schliessen.
Jahr mit der höchsten bewässerten Fläche zwischen 2018 und 2023
Erfasste bewässerte Fläche im Jahr 2023
Geschätzte Effizienz der Bewässerung in der Analyseperiode
Mittlere jährliche Abweichung von der tatsächlichen bewässerten Fläche
English Summary
The article discusses a project by hydrosolutions GmbH in the Canton of Thurgau, Switzerland, which explores the potential of satellite remote sensing for monitoring irrigated areas and estimating water use in agriculture. Using data from WaPOR (FAO) and Landsat, the study assesses evapotranspiration (ET) to differentiate between irrigation water consumption (ETblue) and rainfall use (ETgreen). While the method does not yet allow for precise identification of individual irrigated fields, it provides a plausible estimation of total irrigated areas, correlating well with drought conditions. Results indicate significant yearly variations in irrigated land, influenced by weather conditions, with the highest irrigation in 2023. However, due to data limitations, the estimates should be considered conservative. The study highlights regional differences in water use and the need for further model refinement to improve accuracy and applicability. Future efforts will focus on integrating additional validation data and refining algorithms to support more effective water management in agriculture.
Satellitenfernerkundung im Kanton Thurgau
Die Nutzung von Satellitenfernerkundung ermöglicht innovative Ansätze im landwirtschaftlichen Wassermanagement. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Einsatzmöglichkeiten der Satellitentechnologie zu untersuchen, um auf die Herausforderung von zunehmenden Trockenperioden zu reagieren. Durchgeführt im Auftrag des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau, liefert es Erkenntnisse zum Thema Bewässerung, die für die zukünftige Planung des Brauchwassers von entscheidender Bedeutung sind. Bewässerte Flächen und deren Wasserbedarf können besser erfasst und in die Planung einbezogen werden.
Methodik der Datenerfassung
In diesem Projekt nutzen wir zwei fortschrittliche satellitenbasierte Datensätze, die erst kürzlich für Anwendungen in der Schweiz zugänglich gemacht wurden: das Landsat Provisional Actual Evapotranspiration Science Product und das WaPOR (Water Productivity OpenAccess Portal) Produkt der FAO. Beide Produkte nutzen multispektrale und thermische Satellitendaten, um die Evapotranspiration (ET) zu quantifizieren. ET gilt als Indikator für den Wasserverbrauch der Pflanzen. Unsere Methodik basiert auf der Unterscheidung zwischen ETblue, dem Wasserverbrauch durch Bewässerung, und ETgreen, dem Regenwasserverbrauch der Pflanzen.
Die beiden Komponenten, ETblue und ETgreen, werden unter Einbezug von Landnutzungskarten durch die Analyse der räumlichen Verteilung von ET berechnet. Für die Abschätzung von ETgreen dienen nicht bewässerte Flächen wie Wiesen oder Weiden als Referenz. Dabei wird angenommen, dass der ETgreen-Wert unter denselben wasserlimitierten Bedingungen konstant bleibt, da alle Kulturen denselben Zugang zu Regenwasser haben. Eine einfache Wasserbilanz ermöglicht so die Abschätzung von ETblue, also der Wassermenge, die Pflanzen durch Bewässerung aufnehmen, sowie die Identifizierung bewässerter Flächen.
Das Verhältnis zwischen ETblue und dem totalen landwirtschaftlichen Wasserverbrauch wird als Bewässerungseffizienz bezeichnet. Bei Vorhandensein entsprechender Wasserbezugsdaten kann diese Effizienz berechnet werden. Wasserverluste entstehen beim Transport und bei der Anwendung der Bewässerung. Ineffiziente Bewässerungsmethoden, die mehr Wasser verwenden als die Pflanzen absorbieren können, führen häufig zu einem Wasserverlust von über 50%.
Validierung der Satellitendaten
Die Validierung der Methode erfolgte durch den Vergleich mit Bodenmessungen aus den Jahren 2018-2021 in der Region Broye, wobei präzise Bewässerungdaten von Kartoffelfeldern aus dem Messnetz der Gruppe Ackerbau und Pflanzenzüchtung der HAFL Zollikofen vorlagen. Diese Daten, die im Rahmen des Projekts Bewässerungsnetz erfasst wurden, dienten dazu, die Genauigkeit unserer Satellitenschätzungen zu überprüfen. Die Analyse ergab, dass die Satellitenprodukte WaPOR und Landsat die tatsächlichen Bewässerungsflächen mit einer Genauigkeit von 64% bzw. 57,3% korrekt identifizierten. Die mittlere jährliche Abweichung von der tatsächlichen bewässerten Fläche lag bei WaPOR bei nur 7,6% und bei Landsat bei 20,1% (Abbildung 1). Die Resultate zeigen, dass die Methode zur punktgenauen Identifizierung einzelner bewässerter Flächen noch nicht geeignet ist (siehe Beispiel in Abbildung 2). Die Verwendung von ETblue-Werten aus den Satellitendaten ermöglicht dennoch eine plausible Schätzung der Gesamtbewässerungsflächen, da die regionalen ETblue-Werte mit den vorherrschenden Trockenheitsbedingungen korrelieren. Dadurch kann zumindest das WaPOR Produkt die Unterschiede zwischen den Jahren zuverlässig wiedergegeben (Abbildung 1a). Im Durchschnitt ergibt sich ein Verhältnis von 36% zwischen ETblue (WaPOR-Produkt) und Wasserbezug – ein plausibler Effizienzwert.


Ergebnisse für den Kanton Thurgau
Die Anwendung der Methode auf den gesamten Kanton Thurgau zeigte deutliche Variationen in der jährlichen bewässerten Fläche, abhängig von den Wetterbedingungen. Das Jahr 2023 verzeichnete mit 1.350 Hektar die grösste bewässerte Fläche, während im feuchten Jahr 2021 nur 670 Hektar bewässert wurden. Hier muss angemerkt werden, dass sich die Analyse auf Freilandkulturen beschränkt, welche gemäss Leitfaden Bewässerung als bewässerungswürdig gelten. Kulturen, die eventuell in Ausnahmefällen bewässert werden (Kategorie II), wurden nur in der Nähe von konzessionierten Wasserbezugspunkten betrachtet. Unsere Studie war somit stark abhängig von detaillierten Angaben zu Nutzungsflächen und Wasserbezugspunkten, welche uns das Amt für Umwelt zur Verfügung stellte. Die Abhängigkeit ist dadurch bedingt, dass Validierungsdaten zu bewässerten Flächen im Kanton Thurgau gänzlich fehlen. Für eine uneingeschränkte Anwendung unserer Methode auf alle Nutzungsflächen ist es deshalb noch zu früh.
Unsere Analyse der jährlichen bewässerten Flächen 2018-2023 pro Gemeinde im Kanton Thurgau zeigt, dass die Bewässerung nicht ausschliesslich auf Gemeinden mit offiziellen, konzessionierten landwirtschaftlichen Wasserentnahmepunkten begrenzt ist (Abbildung 3). Vielmehr werden auch andere Quellen, wie beispielsweise das öffentliche Trinkwassernetz, genutzt. Daher ist unsere Schätzung als konservativ zu betrachten und repräsentiert einen Mindestwert der tatsächlich bewässerten Fläche.
Unsere Ergebnisse verdeutlichen signifikante regionale Unterschiede im Bewässerungsaufwand innerhalb des Kantons. Der Bezirk Frauenfeld verzeichnete den höchsten Bewässerungswasserverbrauch, der etwa 15-mal höher lag als im Bezirk Münchwilen. Trotz unterschiedlicher Verbrauchsmengen waren die identifizierten Bewässerungsaufwände pro Hektar in den Bezirken ähnlich; sie lagen im Durchschnitt zwischen 650 und 730 m³/ha. Diese Werte liegen im Bereich der Betriebsdaten der Rathgeb BioProdukte AG (siehe Newsblog vom 16. September 2024), welche den Bewässerungsbedarf von Freilandgemüse und Kartoffeln je nach Wetterlage auf 200 bis 1'000 m³/ha pro Kulturperiode beziffert. Selbst in Jahren mit relativ hohen Niederschlägen, wie 2021 und 2024, sank der Bewässerungsbedarf bei Rathgeb BioProdukte AG nie auf null, was die kontinuierliche Notwendigkeit zur Bewässerung in der Landwirtschaft unterstreicht.

Zukünftige Perspektiven
Diese Ergebnisse unterstreichen das Potential der Satellitendaten zur Unterstützung des Wassermanagements in der Schweiz, weisen jedoch auch auf die Notwendigkeit hin, die Modelle weiter zu verfeinern, um die Genauigkeit zu erhöhen und die Anwendbarkeit in weiteren landwirtschaftlichen Regionen zu testen. Die Methode zeigt Limitationen bei der kleinräumigen Erkennung von Bewässerungsflächen, insbesondere in heterogenen landwirtschaftlichen Gebieten. Unser Vergleich mit den Daten des Projekts Bewässerungsnetz hat ergeben, dass die Qualität der Satellitendaten noch nicht mit präzisen lokalen Messungen vergleichbar ist. Weitere Forschung und Entwicklung ist nötig, um lokale topografische Begebenheiten und Unterschiede in Bodentypen besser zu berücksichtigen.
Für die Zukunft ist geplant, die Genauigkeit der Satellitenschätzungen durch die Integration zusätzlicher Validierungsdaten und die Weiterentwicklung der Algorithmen zu verbessern. Landsat 9 Satellitendaten sind erst ab dem Jahr 2022 verfügbar. Für diesen Zeitraum standen uns keine Validierungsdaten zur Verfügung. Daher konnte das Potential des Landsat-Produkts, das in unseren Vergleichen bisher schlecht abschnitt und nicht für die Anwendung im Kanton Thurgau ausgewählt wurde, noch nicht vollständig erfasst werden. Unser Ziel ist es, ein zuverlässiges Werkzeug zu entwickeln, das Behörden und Landwirten hilft, den Wasserverbrauch effektiver zu planen und zu verwalten.
Downloads
More Projects